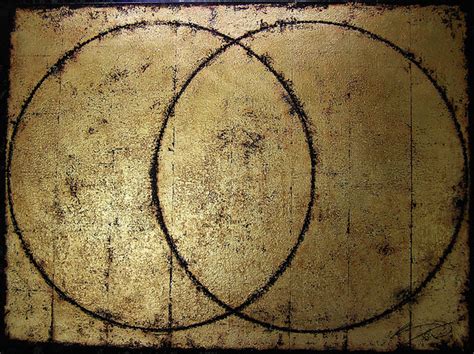Das Licht einer Million Sonnen

Samstagnacht sitze ich auf dem Gepäckträger eines Mannes, der mit einem geliehenen Rad über die Clemensstraße Richtung Münchner Freiheit fährt und dabei unsere Namen singt, seinen und meinen, wie sie vertont und ausgestrahlt wurden in einer schwedischen Fernsehserie für Kinder und auf Grammophonplatten der 30‘er Jahre in Berlin.
Ich weiß, dass er nicht ganz normal ist, der Mann, an dessen Rücken ich mich halte, dass er mit einer Abweichung in der Informationsverarbeitung gesegnet und gefordert ist, oder hängen geblieben auf einer Substanz oder einfach sehr wach und emotional – zu wach für sein Umfeld, zu schnell im Assoziieren.
Das macht aber nichts in diesem Moment, denn wir werden gleich da sein, das Fahrrad abschließen, Schnee von unseren Jacken schütteln und den Aufzug in den sechsten Stock eines Hauses nehmen, wo Linsensuppe wartet und Wunderkerzen brennen, eine Box von der Größe einer Waschmaschine dreißig Menschen beschallt, die noch nicht genug haben, weiterfeiern, laut sein wollen. Zwischen uns, bei uns und um uns herum, sorgt der in einen goldenen Umhang gewandete Gastgeber für anhaltenden Rausch, verfüttert Snacks und füllt Gläser, lässt rote Lichter an der Decke kreisen und die Nebelmaschine laufen, bis niemand mehr erkennbar ist und die Rauchmelder aller Zimmer gleichzeitig piepsen.
Ich tanze mit Thula und einer anfangs schüchternen Ukrainerin und ihren Freunden, dem singenden Fahrradfahrer, zwei Mädchen in Warnwesten, einer vom Gerichtsprozess mit dem Vater ihres Kindes völlig zermürbten Mutter und einem guten Dutzend Händen und Armen, die ich im Nebel nicht personell zuordnen kann.
Ich denke nach, während ich tanze, über den Gastgeber und seine Toleranz hinsichtlich der flächendeckenden Verteilung von Bierlachen auf seinem Parkett, den überall hingeschmissenen Socken, festgetretenem Bananenbrot, verschmierten Theaterschminke, aus dem Schlafzimmer gezogenen Kopfkissen, angekokelten Pflanzen und nach seinem Deoroller riechenden Achseln von Menschen, die soeben sein Bad benutzt haben. Und ich erkenne seine Liebe darin. Und verstehe.
Dies ist sein Traum. Und seine Aufgabe. Sein Angebot an diese Stadt, an uns. Dass wir uns vergessen können, hier, bei ihm, Affen sind, Hände im Nebel, ein Dröhnen im sechsten Stockwerk des Hauses. Der warme Puls einer Februarnacht.
Jeder Mensch hat eine Geste. Etwas, das er geben muss. Etwas, das sie verschleudern will. Wir müssen üppig sein damit, es restlos teilen. Do not go gentle into that good night. Rage, rage, against the dying of the light.
Hier ist es leicht. Auch für mich. Mich zu verausgaben und zu entäußern. Als hätten die Jahrhunderte gewartet auf eine wie mich. Auf eine die zurück liebt; ekstatisch und taumelnd.
When we cease to understand the world.
Mitte des Monats verbringe ich mehrere Abende bei einer Freundin, während sie am Boden sitzt, leise spricht, sich an den Fransen ihres Teppichs hält. Wie wenig symmetrische Gesichtszüge und ein proportional gut gewachsener Körper ausrichten können, wenn die in ihm lebende Person nachts zittert, auf schweißnassen Laken wachgehalten von Angst das Auseinanderfallen aller bisherigen Sicherheiten erlebt, Medikamente nicht mehr greifen, Strategien versagen. Wie soll ich das verstehen, sagt die Freundin immer wieder, ihre Finger im Teppich, die Augen müde. Ich darf nicht kaputt gehen. Ich muss da sein für mein Kind.
Wie soll ich das verstehen, sagt kurz darauf ein anderer Freund, den Kopf weggedreht in seine Schulter weinend. Dass alles weg ist und Erinnerungen schmerzen, auch die guten, gerade die guten. Wann hört das auf? Sind sieben Jahre nicht genug?
In der Fortbildung stellen wir uns als Gruppe einem seit Langem schwelenden Konflikt, in dem jede und jeder Teilnehmende eine klar formulierte Position beziehen, vertreten und in Beziehung mit den anderen bringen muss. Ich erlebe das erste Mal seit ich mit Menschen arbeite, wie ein eigentlich nicht mehr aufhaltbarer galoppierender Gruppenzerbruch ausbleibt, weil ein talentierter und weiser Trainer es vermag, die Beteiligten an den weich-starken Kern ihrer Gemeinschaftsfähigkeit zu geleiten. Ich werde Wochen brauchen, um nachzuvollziehen, wie das möglich war, wie das überhaupt von Statten ging.

Für eine kleine Weile lebe ich in dem Appartement einer Freundin in der Stadt mit einem rosa Kühlschrank und einer Fensterbank, auf der ich esse, lese, die Beine hochziehe und in die Sonne schaue, wenn sie scheint. Meine Arbeitshaltung verändert sich weiter. Wenn ich flach atme, halte ich inne und verlangsame das Tempo. Die Ergebnisse werden unwichtiger, meine Verfassung geht vor. Ich übertreibe es völlig mit dem Kerzenlicht in diesen Ausläufern des Winters und lasse einen nicht geringen Betrag meines Freizeitgeldes in den Drogeriemärkten dieser Stadt, um Nachschub zu gewährleisten. Abends ummantelt mich die turmalinblaue Dämmerung, das Unendliche im Endlichen, ich bin in meinen Gefühlen reich.

An einem kalten Freitagabend teilen wir in einem japanischen Lokal an niedrigen Tischen Algensalat, Bohnen und Reis, schieben die Papiertür des holzverkleideten Zimmers zu und generalüberholen die Gesamtsituation. Es muss viel Jasmintee, Asahi Bier und Mangosaft getrunken werden, bis die jüngsten Entwicklungen aller sechs Anwesenden nachgezeichnet, kommentiert, belacht und befühlt worden sind. Ich höre und notiere das schönste, bayrische Kompliment, das je eine Frau unserer Runde einer anderen Frau aus dem Stegreif zugesprochen hat - Dein Ohrwascherl glänzt – ehe wir uns mit roten Bäckchen und Glückskeksen in den Taschen auf den Heimweg machen.
Dann komme ich zurück aufs Land. Im Haus gegenüber ist eine zerstrittene junge Familie ausgezogen und ein behutsam miteinander umgehendes älteres Ehepaar eingezogen. Morgens trinken sie beim Schein der kleinen Leuchte Tee aus einer Porzellankanne, bringen dann den Müll runter und fahren zur Arbeit. Abends laufen ZDF-Serien über den großen Bildschirm, manchmal telefoniert einer von ihnen beim Kochen. Im Januar hatten sie Freunde zu Besuch, es wurde Schnee geschippt und schmunzelnd auf dem Hof herum gestanden. Erst jetzt, wo der tägliche Streit nicht mehr hör- und sichtbar ist, an anderen Orten stattfindet, beginne ich, das Haus gegenüber wieder zu mögen. Ich schaue gern hin zu der Fassade und sehe den Bewohnern bei ihren Handlungen zu.
Der Winter geht zu Ende, unterdessen es noch einmal kniehoch schneit, die Fichten sich biegen und Füchse auf dunklen Feldern ihr flirrendes Fell dem Mondlicht darbieten.
Nimm mich, Gestirn und Zeit und freier Fall.