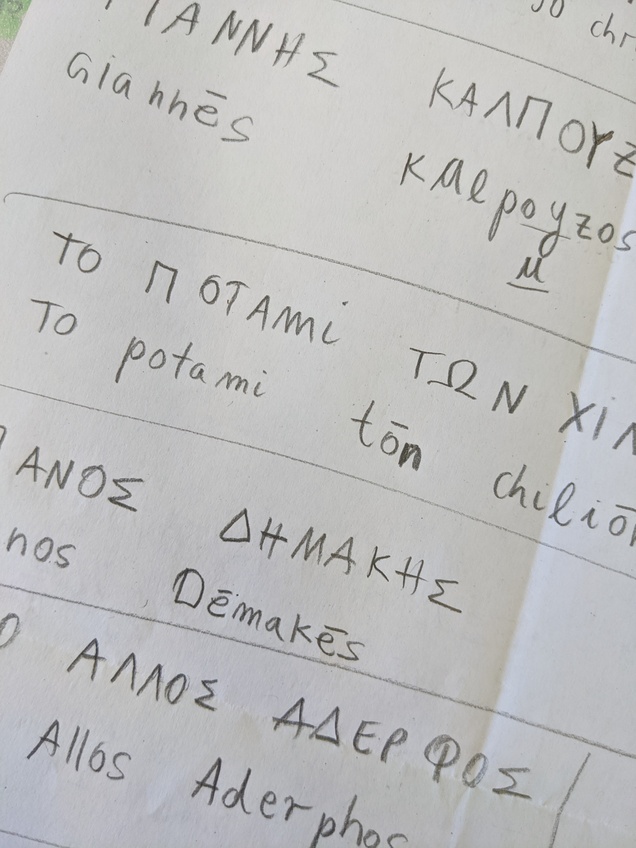Dezember
Währenddessen hat der iranische Freund der Freundin seinen Abschiebebescheid bekommen. Wir sind am Boden zerstört. Es gibt die Möglichkeit, zu klagen. Wir erwägen den Weg. Es wird kostenintensiv, wir sind uns noch nicht darüber im Klaren, wie intensiv. Ich will hier nicht weiter eingehen auf die Details der Absurdität, die es bedeutet, einen hervorragend qualifizierten, verhandlungssicher Deutsch sprechenden, von konkreten Arbeitgebern umworbenen jungen Mann abzuschieben in ein Land, wo er wegen der Teilnahme an Demonstrationen bereits im Gefängnis saß.
I have no life but this.
[Emily Dickinson]
Ich besuche Freunde in einer anderen Stadt, sitze an einem anderen Tisch, im Rücken ein anderes Feuer. Die Wärme dieser 300km entfernten Parallelrealität. Ein paar Stunden in der Gegenwart von intelligenten, durchlässigen Menschen zu verbringen, den Kitt unserer Gesellschaft spüren, diejenigen, die alles zusammen halten, solange es geht.
Es beginnen Wochen, in denen ich mir Dinge vornehme, aber nicht damit rechne, an ihnen teilnehmen zu können. Es schneit, die Straßen sind vereist, die Schneemassen nicht mehr verräumbar. Ich schippe eine Schneise von der Haustür zum Auto. Falls ich den Bahnhof erreiche, ist nicht sicher, ob die S-Bahn fährt, wann und bis wohin. Ab dem Samstag darauf geht gar nichts mehr, die Bewegungen der Stadt kommen zum Erliegen, das dringend benötigte Tanzen entfällt, ich stehe vor dem vergitterten Eingang der dunklen Halle und lege meinen Kopf an den Stäben ab. Ein Winter im Winter im Winter. Es schneit. Ich bin nicht oft zu Hause und wenn, wechsel ich zwischen den Skripten und diagnostischen Regelwerken, ausgebreitet auf verschiedenen Ablageflächen, der Küchenanrichte, dem Teppich. Ich kaufe keine Kerzen, denn ich habe keine Zeit, sie anzuzünden. Am Waldrang springen die Füchse auf der gefrorenen Schneedecke herum. Es schneit weiter. Es schneit ohne Unterbrechung.
Is it too late to touch you?
[Emily Dickinson]
Vier Tage sitze ich auf dem Boden eines ehemaligen Maschinenbetriebs und schaue in die Augen der Anwesenden, betrachte ihre Körper, was sie tragen, was sie senden. Menschliche Begegnung heilt. Nicht ein Gedanke, nicht eine Information, nicht eine weitere Erklärung. Berührt zu werden, angesehen zu werden, wo zu einem vorherigen Zeitpunkt nicht oder falsch berührt, nicht oder falsch angesehen wurde. Diese Erfahrung ist für mich so sättigend, so verblüffend schlicht und final fantasy, dass ich noch Tage später in meiner Wohnung beim Einschlafen mit aufgerissenen Augen auf der Matratze liege und Worte stammel in die Dunkelheit: Ich bin satt. Ich bin satt.
Dabei denke ich auch an meine Körperlehrerin und die Frage, mit der ich vor einer Weile zu ihr gegangen war. Ich fragte sie, ob die konstante Sehnsucht, die ich empfinde, ein unveränderlicher Bestandteil der menschlichen Verfassung ist, ein Hunger nicht stillbar, ein Zustand unlösbar, etwas das mich immer heimsuchen, mich krümmen und auseinanderziehen wird, jeden Tag, jeden Tag, bis ich sterbe und verwandelt werde. Ob ich hinnehmen muss, das zu fühlen. Ob das der Preis ist für meine Lebendigkeit. Oder ob die Sehnsucht auf meiner begrenzten Fähigkeit beruht, Kontakt anzunehmen, aus der Deckung heraus zu kommen und in Verbindung zu gehen, mich einzulassen auf das, was andere mir geben, mich wirklich sättigen zu lassen in Begegnung, Blick und Berührung.
Meine Körperlehrerin sagte: Letzteres.
Am Morgen der Sonnenaufgang, die Konturen des Karwendels nachgezeichnet von Licht. Und dann wird es noch einmal sehr eng. Wenig Schlaf, aufstehen, weitermachen. In der Institution bringe ich mein Jahresprojekt zu Ende, die Inhalte zweier verpasster Kurstage drechsel ich in das Zeitfenster nach dem anderen Job, es gibt Stunden, in denen ich fürchte stumpf zu werden. Mitte des Monats taut es. Der Dezember ist zur Hälfte rum, ich schneide Zweige von den umgestürzten Tannen im Wald und murmel dabei Prognosen zum Verlauf chronifizierter Störungen. Auf einer mir mental nicht ganz zugänglichen Ebene erkenne ich, in diesem Moment umgestaltet zu werden, eine Umgestaltung zu erlauben, die im vorletzten Sommer begonnen hat und sich, unterschiedlich hart von mir ausgebremst, bis in diesen Winter hinein fortsetzt.
that we must suffer, suffer into truth
we cannot sleep
and drop by drop
at the heart
the pain of pain remembered comes again
and we resist
but ripeness comes as well
from the rowing bench
theres comes a violent love
[Chor, Agamemnon]